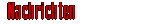

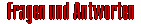
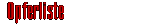
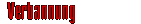
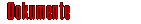
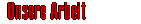



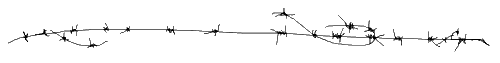
Vor 69 Jahren begann der Streik im Bergbau-Lager in Norilsk

Archiv der FSB-Behörde Russlands für die Region Krasnojarsk
Am 26. Mai 1953 revoltierten Tausende von politischen Gefangenen im Bergbaulager in Norilsk. Die aufgrund politischer Artikel Verurteilten forderten eine Milderung der Haftbedingungen und eine menschliche Behandlung. In den 72 Tagen des Aufstandes wurden nach offiziellen Schätzungen etwa 100 Menschen getötet. Was der Auslöser für den Aufstand war, wie die Gefangenen mehr als zwei Monate unter der Belagerung aushielten und zu welchen Konsequenzen der Aufstand führte - im Material von „Gazeta.Ru“.
Ende der 1940er Jahre wurde auf der Grundlage des Norilsker Strafarbeitslagers (ITL) ein Bergbaulager (Gorlag) eingerichtet, in das hauptsächlich politische Gefangene verbracht wurden. Bis 1952 stieg die Zahl der Häftlinge auf über 20 000 Personen. Sein Vorgänger war ein Zwangsarbeiter-Lager.
«In den frühen 50er Jahren entstanden im Gulag-System spezielle Lager mit
Code-Bezeichnungen wie Steplag, Leslag, Dschidalag. In Norilsk gab es das Gorlag
- die Häftlinge dienten dem örtlichen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb, dessen
Kontingent größtenteils aus Menschen bestand, die eine 25-jährige Haftstrafe
hatten, den so genannten „Schweren“„“, erklärte Sydyp Baldrujev, Historiker und
Doktorand der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung,
gegenüber Gazeta.ru.
Die Sträflinge bauten Erze, Schotter und Ton ab und beteiligten sich am Bau von
Fabriken und Straßen. Sie arbeiteten auch auf Baustellen in Norilsk, die vom „Gorstroj“
beaufsichtigt wurden.
Das Gorlag bestand aus sechs großen Lagerabteilungen mit jeweils 3.500 bis 6.000 Häftlingen. Unter denen, die sich hinter dem Stacheldraht wiederfanden, waren: Soldaten und Offiziere - Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges, Partisanen, KZ-Häftlinge, ehemalige Kriegsgefangene, Bewohner der von Deutschland besetzten Gebiete, die oft „auf Verdacht“ oder „aus Vorsatz“ verhaftet und als ‚Vaterlandsverräter‘, „Komplizen von Henkern“ bezeichnet wurden».
Das Gorlag wurde von einer militärischen Spezialeinheit, den NKVD-Truppen,
bewacht.
«Die Soldaten trieben ihr Unwesen und veranstalteten zur Unterhaltung eine
offene Jagd auf die Gefangenen mit Waffen. Seit den 50er Jahren wurden alle
Baracken nachts von außen verschlossen, bis die Diensthabenden morgens in die
Küche gingen, um Essen zu holen. Die Repressionen bei den geringsten Verstößen
gegen das Lagerregime wurden verschärft.
Während im ITL ein Verstoß in der Regel mit 10 Tagen Strafisolation mit Arbeit
geahndet wurde, war im Gorlag ein Monat in einer strengen Strafzelle mit
eisbedeckten Wänden und jeden zweiten Tag Essen die Regel", schrieb einer der
Gefangenen, Boris Dubitskij.
1952 wurden 1.200 Häftlinge aus anderen Sonderlagern des Regimes - Steplag und Pestchanlag bei Karaganda und Taishhet - ins Gorlag gebracht. Unter ihnen waren Teilnehmer von Lageraufständen, Zusammenstößen mit Kriminellen und Ausbrüchen.
Nach der Niederschlagung der Unruhen in den Lagern von Karaganda wurden die „Aufrührer“ zur ‚Befriedung‘ in die Polarregionen geschickt - die Verurteilten sahen es als ihre Aufgabe an, „die Fackel der Freiheit weiterzutragen“, erinnerte sich der Häftling Jewgenij Grizjak.
Auf dem Weg ins Gorlag wollten Grizjak, der der so genannten ukrainischen Gruppe
angehörte, und einige andere Häftlinge in den Hungerstreik treten, und die
anderen sollten danach anfangenezu streiken. Der Aufstand kam jedoch nicht
zustande. Als Grizjak und einige andere Häftlinge einige Tage später in eine
Siedlung gebracht wurden, die als Durchgangslager diente, kam es zu
Zusammenstößen mit einer der Lagerbanden.
Als Reaktion auf die Drohungen der Bande gegen die Ukrainer durchbrachen die
Gefangenen die Wand ihrer Baracke und begaben sich zu der Baracke, in der die
Täter wohnten. Den Soldaten gelang es gerade noch, die Gefangenen zu trennen.
«Es lohnt sich, den Kontext zu betrachten. Ab Ende der 1940er Jahre begann im Gulag ein „Hexenkrieg“ zwischen Häftlingen, die bereit waren, mit der Lagerverwaltung zusammenzuarbeiten, und „Dieben vor dem Gesetz“. Diese blutige Konfrontation untergrub die Grundlagen der Lagerverwaltung. Noch vor dem Aufstand wurden im Gorlag drei Untergrundorganisationen - „russisch“, „ukrainisch“ und ‚litauisch‘ - auf der Grundlage der Nationalität gegründet", erklärte Sergej Lunew, Historiker und Gründer des Medienprojekts „Vatnikstan“, gegenüber Gazeta.ru.
Außerdem zeichneten sich die „Schweren Jungs“ laut Baldrujew durch ihr unabhängiges Verhalten aus und waren oft in Konflikte mit Häftlingen verwickelt, die nach dem Strafrecht verurteilt worden waren.
"Letztere waren relativ privilegiert, da sie in der Konzeption des Strafvollzugs
ein dem Proletariat und den Bauern klassenmäßig näher stehendes Element waren -
sie wurden aufgrund von Armut und Unterdrückung kriminell. Sie hatten
Privilegien - sie wurden oft als Mitarbeiter der Lagerselbstverwaltung
rekrutiert und hatten Zugang zu bestimmten Vergünstigungen. Diese Art von
Ungerechtigkeit unter den harten Bedingungen des Nordens schuf eine
Konfliktlinie, die jederzeit aufbrechen konnte", so der Historiker weiter.
Als Gryzjak und die anderen in Norilsk ankamen, empfingen die Lagerbewohner die
Neuankömmlinge aus der Ukraine mit Feindseligkeit. Den Erinnerungen Dubizijs
zufolge beschimpften und schlugen die „Alten“ die Neuankömmlinge.
Bald wurde das Lager von einer Reihe von Morden an Häftlingen erschüttert. Alle
Morde ereigneten sich morgens vor dem Arbeitsbeginn. Die Wachen konnten den
Täter nie identifizieren. Die Häftlinge versuchten, in Zweier- oder
Dreiergruppen zusammenzubleiben. Sowohl unter den russischen als auch unter den
ukrainischen Häftlingen wuchs langsam der Gedanke an eine Rebellion, aber sie
wagten es nicht, aktive Maßnahmen zu ergreifen.
Die Situation wurde durch das mangelnde Vertrauen zwischen den beiden Völkern
noch verschärft.
Die Situation im Lager verschlechterte sich nach dem Tod Josef Stalins -
obwohl eine Amnestie folgte. Denn die politischen Häftlinge waren von der
Amnestie nicht betroffen.
«5. März 1953, Stalin stirbt. Es beginnt die Zeit, die in der
Geschichtsschreibung als „100 Tage Berija“ bezeichnet wird. Der ehemalige
stalinistische Volkskommissar für innere Angelegenheiten begann mit
Unterstützung des sowjetischen Regierungschefs Malenkow, eine Politik der
schrittweisen Liberalisierung zu verfolgen. Zu Berijas Initiativen gehörte auch
eine Amnestie für Gefangene", so Lunew..
Die Situation in Gorlag verschärfte sich durch einen weiteren Mord - dieses Mal waren die Täter Wachmänner. Bei dem Versuch, eine alltägliche Situation zu lösen, eröffneten die Soldaten das Feuer, töteten eine Person und verletzten mehrere andere.
«Am 25. Mai 1953 gingen wir zur Arbeit. Alle sind deprimiert; wir beginnen nicht mit der Arbeit. Plötzlich knistert ein Maschinengewehr in der Nähe der fünften Zone, die nicht weit vom „Gorstroj“ entfernt ist. Aus irgendeinem Grund waren wir uns sicher, dass es auch dieses Mal keine Opfer gab. Schließlich erfuhren wir, dass einer getötet und sechs verwundet worden waren", schrieb Gryzjak.
Die Arbeit kam zum Stillstand, die Häftlinge gerieten in Panik. Jemand rief: "Wir werden umgebracht! Lasst uns nicht arbeiten! Rufen wir eine Kommission aus Moskau an!»
Die Empörung der Häftlinge ließ jedoch allmählich nach, und alle gingen wieder an die Arbeit. Die Unterstützer des Aufstandes versuchten, die anderen Häftlinge zum Streik zu bewegen, aber sie zögerten. Dann gelangte Gryzjak zur Kompressorstation, die das gesamte Gorstroj mit Druckluft versorgte, und legte sie lahm. Auch die Arbeit wurde eingestellt.
Der Norilsker Aufstand begann spontan und nicht gleichzeitig. Die vierte Lager-Abteilung (3.500 Personen) und die 1.500 im Gorstroj-Verbund verbliebenen Häftlinge verweigerten am 25. Mai die Arbeit. Die fünfte und sechste Zone streikte in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai, nachdem im Wohnbereich der fünften Lager-Abteilung auf Häftlinge geschossen worden war. Die 1. Abteilung schloss sich dem Streik erst am Nachmittag des 1. Juni an, und die Sträflinge (die dritte Lager-Abteilung des Gorlag) beteiligten sich erst am 4. Juni an dem Streik, als eine weitere Schießerei des Wachpersonals sieben Menschen tötete.
Die Demonstranten forderten ein Ende der Willkür des Wachpersonals, einen Wechsel der Lagerleitung, eine Verbesserung der Haftbedingungen und der medizinischen Versorgung im Gorlag. Zu den Forderungen gehörten insbesondere: Verkürzung des 10-12-stündigen Arbeitstages auf 7-8 Stunden, Auszahlung des verdienten Geldes. Außerdem verlangten sie die Aufhebung der Beschränkung des Briefverkehrs mit Angehörigen (bisher durften sie zwei Briefe pro Jahr schreiben), die Abschaffung des Tragens von Nummern auf der Kleidung, die Entfernung der Gitter an den Fenstern der Baracken und der Schlösser an den Türen. Die Häftlinge erklärten sich bereit, nur mit einer Kommission aus Moskau zu verhandeln.
Die Lagerleitung trat zur Seite, beeilte sich aber nicht, die Kommission anzurufen. Stattdessen stellte sie die Essensausgabe an die Häftlinge ein und schlug ihnen vor, für Verpflegung ins Lager zurückzukehren.
«In der Tat funktionierte der Komplex 72 Tage lang auf der Grundlage der Selbstorganisation. Das Wort „Aufstand“ wurde nicht verwendet, sie nannten ihren Protest einen „Streik“, was die Ereignisse besser beschreibt. Die Dauer des Aufstandes erklärt sich aus internen Gründen - die Häftlinge, von denen es Tausende gab, schlossen sich zusammen und organisierten die Selbstverwaltung. Gorlag war weit entfernt, was zu Problemen bei der Anforderung von Verstärkung führte. Außerdem hatten die Aufständischen selbst Kampferfahrung", sagte Lunew.
Dem Historiker zufolge hatten auch externe Faktoren einen Einfluss. Der Gulag wurde vom Innenministerium in das Justizministerium verlegt, was zu einem organisatorischen Durcheinander führte.
«Der Streik begann während der „100 Tage von Berija“ und endete nach der Verhaftung des Innenministers. Es gab einen Kampf um die Macht an der Spitze, und das lag, grob gesagt, nicht am Gorlag", fügte er hinzu..
Die Gorlag-Häftlinge schufen eine Art „Lagerstaat“. In der 1., 3., 4., 5. und 6. Lager-Abteilung wurden Selbstverteidigungsabteilungen des Lagers organisiert - Wachen, die sich aus Häftlingen zusammensetzten, die in Schichten Wache hielten, um Brände und andere Katastrophen zu verhindern und Provokationen seitens der Lager-Administration zu unterbinden.
So wurden zum Beispiel ein Krankenhausbrand, eine Transformatorenexplosion und eine Explosion von Eisenbahnschienen im Abschnitt der 1. Lagerabteilung abgewendet. Dort durchtrennte in der Nacht zum 6. Juni bei starkem Nebel einer der Offiziere den Draht und versuchte, auf ungewöhnliche Weise in die Zone einzudringen - rückwärts, indem er Fußspuren im frisch gefallenen Schnee hinterließ, die den Anschein erweckten, dass jemand geflohen war. Diese und viele andere Provokationen wurden von den freiwilligen Wächtern des Lagers verhindert.
Die Patrouillen und Beobachter waren mit keinerlei Waffen ausgerüstet. Allerdings waren in den Zonen immer Ziegelsteine vorhanden, die zur Abdeckung der Wegränder verwendet wurden. Die Lagebinsassen efürchteten nicht zu Unrecht, dass der Streik unterdrückt werden könnte, indem ein Konvoi von mit Messern und Stöcken bewaffneten Kriminellen in die Zone geschickt würde.
Nach dem Sturz der LagerAministration und der „Einnahme“ des Gorlag befassten sich die Häftlinge mit der Renovierung der Baracken, reinigten das Gelände, lieferten täglich Berichte und Bulletins für die Lagadministration, die Schuster- und Schneiderwerkstätten, das Badehaus arbeiteten ununterbrochen, die Baracken und andere Gebäude und Räumlichkeiten wurden regelmäßig gesäubert, die Ambulanz und das Krankenhaus funktionierten, bettlägerige chronische Patienten und Invaliden wurden versorgt, der Essensdienst war regelmäßig in Betrieb.
Nachdem 40 Tage seit der letzten Erschießung vergangen waren, wurden im Club Konzerte veranstaltet. Das friedliche Leben ging weiter, obwohl ab dem ersten Tag des Streiks der Strom abgestellt worden war.
Die Moskauer Kommission und die Leitung des Gorlag gingen schnell von Überzeugungsarbeit zu Drohungen über, in der Hoffnung, die Gefangenen einzuschüchtern und sie zu zwingen, ihre Situation zu akzeptieren.
Die Provokationen in den Zonen geschahen immer häufiger. Um sie zu bekämpfen, waren die Ausschüsse gezwungen, Ermittlungsabteilungen, Sonderkommissionen und eine eigene Spionageabwehr einzurichten, die sich mit der Suche nach Kriminellen, der Untersuchung ihrer Aktivitäten und der Erstellung von Listen von „Spitzeln“ befasste.
Am 29. Juni beschloss die Verwaltung, die 5. Lager-Abteilung zu liquidieren. Dabei wurden Waffen eingesetzt. 11 Menschen wurden getötet, 36 schwer verwundet, 12 von ihnen erlagen später ihren Verletzungen.
Im Lager wurden Lautsprecher installiert. Ein Vertreter der Moskauer Kommission wandte sich an die Lagerinsassen. Er verurteilte die Streikbewegung im Allgemeinen und betonte, dass er sich bewusst sei, dass die meisten Gefangenen noch ein oder zwei Jahre bis zum Ende ihrer Strafe hätten und sie die Extremisten offensichtlich nicht unterstützten, sondern Angst vor ihren terroristischen Aktionen hätten.
Er forderte alle Personen, die mit den Aktionen der Streikenden nicht
einverstanden waren, auf, das Gelände zu verlassen. Zu diesem Zweck wurde der
Zaun des Geländes an bestimmten Stellen durchgeschnitten, und die Soldaten der
Wache wurden angewiesen, alle Personen beim Verlassen des Lagers zu unterstützen.
Im Falle der Weigerung, diesem Befehl nachzukommen, sollte die bewaffnete
Niederschlagung des Widerstands angeordnet werden.
Die Rede endete mit den Worten: "Habt keine Angst, wir werden euch helfen“!
In der Nacht zum 7. Juli wurde die 6. (Frauen-) Lager-Abteilung gestürmt. Zunächst wurden die Gefangenen mit Wasser unter einem Druck von acht Atmosphären übergossen, dann wurden sie einzeln aus dem Lager gebracht. Am selben Tag beendeten das 1., 4. und 5. Lagerabteilung ihre Streiks. Am längsten hielt das 3. (Zwangsarbeits-) Lager durch. In der Nacht zum 4. August wurde es gestürmt. Bewaffnete Männer in Autos drangen in die Lager-Zone ein und eröffneten das Feuer. 57 Menschen wurden getötet, 98 verletzt.
Bald kehrten alle Häftlinge in ihre Abteilungen zurück, und die normale Arbeit wurde wieder aufgenommen. Den Forderungen der Aufständischen wurde schließlich Rechnung getragen: Das Tragen von Nummern auf der Kleidung wurde abgeschafft, die Zahl der Arbeitsstunden wurde reduziert und die Baracken wurden nachts nicht mehr geschlossen. Einige Monate später wurden die so genannten Kredite wieder eingeführt: Gewissenhaft arbeitende Häftlinge erhielten für einen Arbeitstag eineinhalb oder zwei Tage Strafanrechnung.
Am 27. August wurde eine große Gruppe aktiver Teilnehmer des Norilsker Aufstands aus Dudinka nach Krasnojarsk gebracht. Die Aktivisten kamen in das interne Gefängnis des Innenministeriums in Krasnojarsk. Die übrigen schaffte man in verschiedene Lager: in die Region Magadan, nach Kengir (Dschekasgan), Mordowien, in Gefängnisse in Irkutsk, Wladimir und Kurgan.
Offiziellen Schätzungen zufolge wurden bei dem Aufstand etwa 100 Menschen getötet und über 200 verwundet. Nach Schätzungen von Gefangenen gab es mehr als tausend Opfer.
Unmittelbar nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes wurde das Gorlag offiziell geschlossen und das Lager in das Norilsker Strafvollzugssystem eingegliedert, so der Historiker Lunew.
«Das Gulag-System selbst wurde merklich reformiert. Der Norilsker Aufstand wurde zu einer Art Katalysator für den rebellischen Geist. Zeitgleich mit den 72 Tagen des Gorlag entwickelte sich der Workuta-Aufstand nach einem ähnlichen Szenario - er dauerte 10 Tage. Es gab auch andere, weniger bekannte Häftlingsdemonstrationen", fügte er hinzu.
Nach und nach ging die Zahl der politischen Gefangenen zurück - bis 1956 um mehr als das Vierfache - von 467.000 auf 114.000. Es gab immer weniger neue Verfahren nach politischen Artikeln, und die alten, nach denen die Verurteilten ihre Strafe verbüßt hatten, wurden überprüft. Von 1954 bis 1956 waren Sonderkommissionen tätig, um die Rechtmäßigkeit der Anwendung der politischen Artikel zu überprüfen.
«Auch die Haftbedingungen für die Häftlinge wurden gelockert und die Verwaltungsstruktur des Gulag änderte sich. Anfang 1954 wurde der Gulag wieder dem Innenministerium unterstellt, 1956 reorganisiert und 1959 in die Hauptdirektion der Gefängnisse umbenannt. In diesen Jahren fand die Aufweichung des Regimes in verschiedenen Bereichen statt, so dass es nicht sinnvoll ist, sie ausschließlich mit dem Aufstand im Gorlag in Verbindung zu bringen, aber sie spielte eine wichtige Rolle", schloss Lunev..
Jan Sturm
Gaseta.ru, 26.05.2022