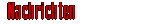

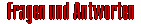
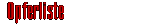
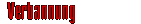
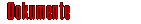
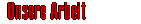



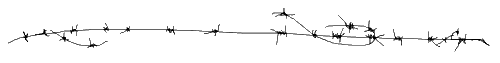
Die krasnojarsker Gesellschaft «Memorial» sammelt Zeugnisse über verfolgte Personen aus unterschiedlichen Quellen – von Archivdokumenten bis hin zu mündlichen Zeugenaussagen. Die ideale Variante wäre selbstverständlich, Zugang zu Quellen zu erhalten, die umfassende Informationen über alle Repressionsopfer einer bestimmten Kategorie beinhalten. So wurden bei der Vorbereitung zum Buch der Erinnerung an die Opfer der politischen Repressionen in der Region Krasnojarsk alle Archiv- und Ermittlungsakten, die sich im Besitz von krasnojarsker Archiven (russische FSB-Behörde und Staatsarchiv der Region Krasnojarsk) befinden, durchgearbeitet, und für die «Bauern»-Bände – alle Dokumente über entrechtete Personen aus den Bezirks-Archivbeständen. Natürlich gibt es auch Personen, die nicht in diese Listen aufgenommen wurden, weil die entsprechenden Dokumente nicht aufbewahrt wurden, aber insgesamt gesehen sind diese Listen – maximal vollständig.
In den Jahren 2021-2022 haben wir zwei weitere umfassende Listen erarbeitet.
Bei der ersten handelt es sich um eine Aufstellung der aus Litauen in die Region Krasnojarsk Deportierten (anhand von Angaben des Zentrums für die Erforschung des Völkermords und des Widerstands der litauischen Bevölkerung). Die Auswahl aus der Datenbank mit 46.425 Personen ist in litauischer Sprache verfügbar und wurde von uns innerhalb von etwa einem Jahr ins Russische übersetzt. Die Geschichte der Übersetzung und die dabei aufgetretenen Probleme verdienen einen eigenen Bericht.
Im zweiten Fall geht es um Deportationslisten von Deutschen, die 1941 aus der ASSR der Wolgadeutschen in die Region Krasnojarsk verschleppt wurden. Man könnte meinen, dass solche Listen im Archiv des Innenministeriums aufbewahrt werden sollten, aber tatsächlich befinden sie sich im Staatsarchiv. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass sie offiziell nicht als deportiert, sondern als evakuiert registriert waren (in den Bezirksarchiven finden sich Listen mit den Namen der „Evakuierten“). Außerdem wurden die deportierten Deutschen, im Gegensatz zu beispielsweise den entkulakisierten Bauern, die hauptsächlich in Sonderlager der OGPU geschickt wurden, in gewöhnlichen Dörfern angesiedelt, wobei dies Aufgabe der Bezirksexekutivkomitees war (natürlich unter der Kontrolle des NKWD).
Im Jahr 2020 begann das GAKK (Staatsarchiv der Region Krasnojarsk) mit der Digitalisierung von Zug-Transportlisten und der Veröffentlichung von Scans auf seiner Website. Gleichzeitig startete die Krasnojarsker Gesellschaft „Memorial“ gemeinsam mit einer Gemeinschaft von Genealogen ein Projekt zur Indexierung von Deportationslisten. Die Listen werden in Excel nach Regionen erstellt, so wie sie sind, obwohl sie offensichtlich viele Fehler enthalten. Diese Fehler werden in den folgenden Schritten korrigiert, wobei das Ziel darin besteht, das Originaldokument so genau wie möglich wiederzugeben. Dies ist keine ganz einfache Aufgabe, da ein Teil der Transport-Listen handschriftlich und nicht maschinengeschrieben ist. Dieser Teil der Arbeit wird von ehrenamtlichen Genealogen durchgeführt, die geografisch über den gesamten Globus verstreut sind. Die Koordination dieser Arbeit und die abschließende Kontrolle übernimmt der Genealoge Jewgenij Sasanzew aus Krasnojarsk.
Im nächsten Schritt werden die Listen nach Gebieten aus der Tabellenform in eine Textform umgewandelt, nach Familien und alphabetisch sortiert. Dabei werden alle geografischen Bezeichnungen überprüft und korrigiert, Abkürzungen entschlüsselt. Diese Arbeit wird von Swetlana Sirotinina erledigt. Die Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen in den Deportationslisten sind russifiziert und mit gravierenden Fehlern geschrieben. Wir stellen die korrekte deutsche Schreibweise wieder her, was ebenfalls nicht immer einfach ist, aber in unserem Team arbeitet Sibyll Saya aus Lübeck (BRD), die dieses Problem löst.
Die Hauptursache für den Fehler liegt in der Art und Weise, wie das Formular ausgefüllt wurde. Es ist offensichtlich, dass die Listen von Personen erstellt wurden, die keine Deutschkenntnisse hatten. Dies geschah entweder beim ersten Ausfüllen der Listen in der ASSR der Wolgadeutschen oder beim Nachdrucken in den Bezirks-Exekutivkomitees der Region Krasnojarsk, wahrscheinlich sogar an beiden Orten. So verwandelten sich die Kolchose «Neuer Weg» in «Newe», Disendorf in Diesendotsch, Regina in Eringinu.
Bei diesem Schritt entstand ein unerwartetes Problem. Zunächst haben wir den Namen Andrej in den deutschen Namen Andreas „zurückverwandelt“. Allerdings wurden oft auch Heinrichs zu Andrejs und nicht nur Friedrichs zu Fedors, sondern auch Theodors. Deshalb haben wir beschlossen, den russifizierten Namen beizubehalten und in Klammern Varianten anzugeben, zum Beispiel „Andrej (Andreas/Heinrich)“. Das ist auch deshalb wichtig, weil er in allen Dokumenten aus der Zeit nach der Deportation bereits als Andrej geführt wurde und seine Verwandten ihn unter diesem Namen in den Listen suchen werden. Von dieser Art Probleme gab es nicht wenige. So stießen wir sehr häufig auf den Namen Bogdan, obwohl er im Deutschen eigentlich nicht existiert. Das deutsche Analog ist Theodor, was mit «von Gott geschenkt» übersetzt wird. Anscheinend wurden Theodors oft als Bogdans aufgeführt, wie die Deportierten selbst berichteten. Eine weitere typische Doppeldeutigkeit ist der Name Emalia. Einen solchen deutschen Namen gibt es nicht. Höchstwahrscheinlich wurde so Amalia geschrieben, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass es auch Emilia war. Deshalb schreiben wir Amalia so: „Amalia/Emilia“
Es scheint, dass die Listen danach auf die Website gestellt, in die Datenbank eingegeben usw. werden können, aber die Praxis hat gezeigt, dass der endgültige, überprüfte Text erst nach der Übersetzung ins Deutsche vorliegt (die Sibyll übernimmt). Bei der Übersetzung werden Fehler entdeckt, die beim Durchsehen der Liste mit „verschleiertem” Blick bisher nicht aufgefallen sind. Diese Fehler werden umgehend korrigiert, und anschließend erscheinen auf der Website beide korrigierten Listen gleichzeitig – in russischer und deutscher Sprache. Damit ist die Arbeit noch nicht beendet – die Listen müssen in die Datenbank eingegeben und unter Angabe der Quelle in die allgemeine Liste der Repressionsopfer aufgenommen werden.
Ich habe den Prozess der Verarbeitung von Deportationslisten ausführlich beschrieben, um zu verdeutlichen, dass die ursprüngliche Liste, selbst in indexierter Form, weder für die Suche nach Personen noch für statistische Auswertungen geeignet ist.
Die Struktur der Transportlisten sieht folgendermaßen aus:
Erforderliche Anmerkungen:
1. In der Regel ist in der ersten Spalte die Nummer der Familie und in der zweiten Spalte die Nummer des Familienmitglieds angegeben, obwohl in einigen Gebieten eine durchgehende Nummerierung innerhalb des Blattes verwendet wird und man Familien nur dadurch voneinander unterscheiden kann, dass der Familienvorstand an erster Stelle der Liste steht.
2. Die Nachnamen sind in der Regel fehlerhaft geschrieben, die Vornamen und Vatersnamen sind entweder russifiziert oder fehlerhaft geschrieben.
3. Sowohl der Geburtsort als auch der Wohnort sind voller Fehler und Abkürzungen. „Selman“ statt „Seelmann“, „Polt“ statt „Staropoltawskij“, „Palast“ statt „Pallasowskij“, „Marksam“ statt „Maxstadt“ usw. Darüber hinaus wurden sich wiederholende Werte in der Spalte durch „-//-“ ersetzt. Das bedeutet, dass eine automatische statistische Verarbeitung dieser Felder erst nach vollständiger Korrektur der Fehler und Wiederherstellung der sich wiederholenden Werte möglich ist.
4. Nationalität – nicht immer handelt es sich um Deutsche. Unter den
Familienmitgliedern befanden sich häufig russische Ehefrauen, Kinder und sogar
Ehemänner. Es kam nicht selten vor, dass das Familienoberhaupt eine Russin war,
die mit einem Deutschen verheiratet war, der offenbar verstorben war, die Kinder
als Deutsche registriert waren und die Familie ausgewiesen wurde.
5. Die „beruflichen“ Merkmale werden detailliert beschrieben: nicht nur der
Beruf, sondern auch die Einrichtung und die Art der ausgeübten Tätigkeit.
Offensichtlich war dies notwendig, um die Deportierten am Ort ihrer Verbannung
effektiver einzusetzen, und oft sehen wir, dass ein Arbeiter der Maschinen- und
Traktoren-Station aus dem Wolga-Gebiet zur Maschinen- und Traktoren-Station im
Bejsker Bezirk der Region Krasnojarsk geschickt wird, Arbeiter der
Bezirks-Konsumgenossenschaft zur Bezirks-Konsumgenossenschaft usw. Wir kennen
jedoch auch andere Fälle – beispielsweise, dass eine Kandidatin der
Pädagogikwissenschaften als Schweinehirtin in einer Kolchose arbeitete und ihr
nicht gestattet wurde, an einer Schule zu arbeiten.
Die Arbeit an den Deportationslisten wird fortgesetzt. Er aktuelle Stand kann eingesehen werden unter:
https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/People/_Lists/ASSRNP/0.htm.
Aber auch nach der Bearbeitung der Deportationslisten der aus der ASSR der Wolgadeutschen deportierten Personen wird das Thema der Deportation der Deutschen nicht abgeschlossen sein. Es gab noch einen Strom von „Leningrader” Deutschen (und Finnen) im Jahr 1942, und wir haben bereits einen Teil dieser Listen im Archiv der GAKK gefunden, sowie einen Strom von „südlichen” Deutschen in den Jahren 1944-1945, aber diese Listen sind kaum noch öffentlich zugänglich, und die Archive des Innenministeriums sind leider derzeit für Forscher geschlossen.
Veröffentlicht: Das Recht auf den Namen: Biografie des 20. Jahrhunderts. Jofe-Stiftung, 2023