










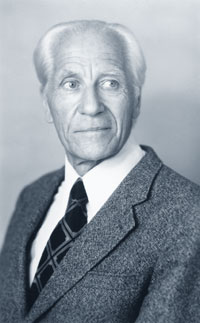 Ich war im Verteidigungsbereich tätig und war vom Militärdienst befreit, aber
ich lehnte die Freistellung ab und ging zur Armee. Ab dem Beginn des Krieges
hielt ich mich für kurze Zeit in der Nähe von Moskau auf und diente anschließend
im sowjetischen Expeditionskorps im Iran. Mehrmals stellte ich ein Gesuch, um an
die Front zu gehen, aber anstatt an die Front fuhr ich 1943 nach Norilsk in die
Verbannung.
Ich war im Verteidigungsbereich tätig und war vom Militärdienst befreit, aber
ich lehnte die Freistellung ab und ging zur Armee. Ab dem Beginn des Krieges
hielt ich mich für kurze Zeit in der Nähe von Moskau auf und diente anschließend
im sowjetischen Expeditionskorps im Iran. Mehrmals stellte ich ein Gesuch, um an
die Front zu gehen, aber anstatt an die Front fuhr ich 1943 nach Norilsk in die
Verbannung.
Mein Vater, Alexander Robertowitsch Kisel, ein sowohl bei uns als auch im Ausland bekannter Wissenschaftler und Biochemiker, wurde im Alter von 63 Jahren verhaftet. Er leitete den Lehrstuhl an der Staatlichen Moskauer Universität. Während der Durchsuchung bei uns zuhause wurden all die wenigen wertvollen Sachen konfisziert (die Tschekisten stopften sie sich in die Taschen) und die Bücher und Manuskripte des Vaters wurden abtransportiert. Aufgrund des Ukas des Führers der kommunistischen Partei „begeben sich Familienmitglieder, die nicht an Verbrechen beteiligt sich und darüber auch nichts wissen, für fünf Jahre in die Verbannung“. 1955 erhielt ich ein Stückchen Papier: „A.R. Kisel wurde verhaftet und ohne Anklageschrift, Ermittlungsverfahren und Gerichtsurteil, trotz Mangel an Tatbeständen, verurteilt; er gilt als posthum rehabilitiert“. (Es gab auch eine Bescheinigung über seinen Tod im Jahre 1948, wo in der Spalte „Todesort“ ein Strich gezogen wurde). Ein analoges Dokument erhielt ich später ebenfalls, allerdings ohne das Wort „posthum“.
Das letzte Buch des Vaters, das er zusammen mit seinen Mitarbeitern schrieb, erschien angesichts seiner Bedeutsamkeit in der 2. Ausgabe im Jahre 1952, aber sein Nachname war auf Verlangen der Zensur von der Autorenliste gestrichen.
All das war später, aber einstweilen hielten sie mich mehrere Tage im Gefängnis fest – bis sie eine ausreichende Menge Verbannter und Gefangener (im Schnellverfahren) für eine Etappe zusammengestellt hatten und in einem Spezialwaggon nach Krasnojarsk brachten. Im benachbarten Sonderwagen befanden sich Frauen, die an irgendeinen anderen Ort ausgesiedelt werden sollten, einige von ihnen hatten Kinder in Windeln bei sich. Meine Mama aus Moskau brachten sie ebenfalls woanders hin, ich machte sie erst viel später ausfindig.
An jeder Bahnstation hielt der Zug an, ein paar Gefangene wurden abgeliefert, andere ließ man einsteigen: scheinbar war ganz Sibirien ein einziges großes Konzentrationslager. An einem der kleinen Bahnhöfe trugen sie einen schwerkranken „Alten“ (57 Jahre) herein. Er stammte aus dem schrecklichsten Straflager „Iskitim“. Dort arbeitete eine Kolonne aus 200 Männern in einem Steinbruch. Als die Häftlinge nach Arbeitsende Aufstellung nahmen, fehlte einer. Während ein Teil der Wachen loszog, um ihn zu suchen (er war in einer Schlucht eingeschlafen), stand die Kolonne zwei Stunden wartend im eisigen Herbstwind. Deswegen hatte der „Alte“ sich eine Lungenentzündung zugezogen.
 Unterwegs wurde ich mit einer größeren Partie Menschen mehrere Monate lang in
einem Kohleschacht des Kusnezker Beckens (Osinniki) festgehalten. Die feuchten
und kalten Schachtanlagen waren einst von Gefangenen angelegt worden, und jetzt
arbeiteten dort enteignete Bauern. Ihr landwirtschaftliches Inventar hatten sie
nicht mitnehmen dürfen, deswegen gab es für sie keine andere Arbeit zu
verrichten, als die im Schacht, wo ein natürlicher Menschenschwund einsetzte und
es an Sklavenarbeitern fehlte. Ich war als Gehilfe des Hauers sowie als
Holzzusteller tätig.
Unterwegs wurde ich mit einer größeren Partie Menschen mehrere Monate lang in
einem Kohleschacht des Kusnezker Beckens (Osinniki) festgehalten. Die feuchten
und kalten Schachtanlagen waren einst von Gefangenen angelegt worden, und jetzt
arbeiteten dort enteignete Bauern. Ihr landwirtschaftliches Inventar hatten sie
nicht mitnehmen dürfen, deswegen gab es für sie keine andere Arbeit zu
verrichten, als die im Schacht, wo ein natürlicher Menschenschwund einsetzte und
es an Sklavenarbeitern fehlte. Ich war als Gehilfe des Hauers sowie als
Holzzusteller tätig.
Danach schickten sie uns nach Krasnojarsk. Hier erhielt ich eine Arbeitsanweisung für die Sowchose „Taiga“ des dem MWD unterstellten Norilsker Kombinats, die sich nicht weit von Suchobusimo entfernt befand, der Heimat von W.I. Surikow, neben dem Dorf Atamanowo, wo der Jenisej aus einer Felsenenge hervorbricht. Dahinter, etwas weiter stromaufwärts, war die Siedlung der hierher verschleppten Kalmücken gelegen.
Das Kombinat war faktisch der Herrscher über die gesamte Krasnojarsker Region, weil es das einzige Unternehmen in der Sowjetunion war,, das Nickel und Kobalt förderte, welche zum Kochen von hochwertigem Stahl erforderlich sind, sowie begleitende Platinmetalle. Die Natur versorgte den Norilsker Bezirk mit Steinkohle-Vorkommen. Entlang des gesamten Jenisej gab es Lagerhäuser, Werften, Anlegestellen, Fischereiwirtschaften und Holzfabriken, die dem Kombinat angehörten. Die Sowchose versorgte das Kombinat mit Kartoffeln und Gemüse.
Es gab einige freie Mitarbeiter aus den umliegenden Dörfern, aber in der Hauptsache wurde die Sklavenarbeit von einer großen Häftlingstruppe geleistet. Ich wurde als „Ingenieur“ in die Traktoren-Reparatur-Werkstatt geschickt. Damals kannte ich mich in solchen Dingen kaum aus, aber ich erinnere mich bis heute an die Gefangenen, besonders den erfahrenen Kriminellen Schwetz – Schmied von Beruf, der einen Floh allein mit der linken Hand beschlagen konnte, Wolodja Panow – Schlosser, mit den glänzenden Fähigkeiten eines Konstrukteurs, Kolja Trubezkij (ein entfernter Nachfahre der Trubezkijs) und viele andere Menschen, die ihr Handwerk verstanden.
In der Sowchose war ein bereits betagter Fuhrmann tätig; er war mit der ersten Partie enteigneter Bauern Anfang der 1930er Jahre eingetroffen, hatte an irgendeinem wichtigen Bauprojekt des Kombinats gearbeitet und war später hierhin umgezogen, wo die Arbeit für ihn leichter war. Einmal kehrte er in nassem, matschigem, kaltem Novemberwetter, ganz zum Schluss des Arbeitstages, frierend zurück. Wir tranken zusammen starken Tee und erhielten uns über seine vorherige Arbeit.
- Nun, es kam vor, dass in einer derart kalten Nacht alle zuhause saßen und man nicht einmal einen Hund hätte vor die Tür jagen mögen, und man mir genau dann eingehende Anweisungen erteilte, weil ich Leichen transportieren sollte. Sie laden das Fuhrwerk voll – und dann fährst du durch den tiefen Dreck, und die Pferde werden vollkommen überanstrengt. Ich fahre an die große Grube heran, die sie mit Hilfe einer Maschine ausgehoben haben. Ich war damals jung, kräftig; ich schaffte es , das Fuhrwerk mit der Schulter anzuheben und die Fracht in die Grube zu kippen. Dann fuhr ich wieder zurück … Gegen Morgen - konnte ich mich ausruhen. Und gegen Morgen kamen Maschinen und schütteten die Grube zu….
Im Herbst schichten sie das gesamte Personal ohne Auswahlverfahren zum Kartoffeln-Sammeln und Verladen auf Lastschiffe. Einmal kam der Leiter des Kombinats, MWD-Generalmajor Panjukow, mit einem Wasserflugzeug zur Sowchose. Er wollte mit seinem Gefolge von Krasnojarsk nach Norilsk fliegen und schaute auf dem Wege dorthin kurz bei den Unternehmen herein. Rein zufällig erfuhr einer seiner Leute, dass ich Physiker von Beruf war; er meldete das seinen Vorgesetzten, und Panjukow meinte: „Wir haben nicht genügend Leute mit dem Profil – ich werde ihn mitnehmen“. Nachdem ich in aller Eile meinen Soldatenrucksack gepackt hatte, wurde mir die Ehre zuteil, mit dem Leiter höchstpersönlich ins Flugzeug zu steigen.
Seine Gefolgsleute führten die üblichen Bürokraten- und Beamtengespräche – wer in welchem Sessel saß, wer einen Sprung nach oben gemacht hatte, wer ein schlaue Notiz auf ein Papierchen geschrieben hatte … Ganz unfreiwillig flochten sie Berichte über in der Taiga verschwundene Flugzeuge mit in ihre Unterhaltung ein, über den in stürmische Bewegung geratenen Jenisej, durch den eine ganze Karawane von Lastkähnen bei Igarka auseinandergeworfen worden war, über einen völlig unerwartete heranbrausenden Schneesturm, über riesige Schneewehen … Unterwegs wurde immer wieder gelandet, und Panikow setzte sein Vorhaben fort, allen Unternehmen einen kurzen Besuch abzustatten – in einigen blieb er gerade ein Viertelstündchen, in anderen auch länger.
Zu jedem Betrieb gehörte auch ein kleines Gästehaus für die Obrigkeit, das über eine ständige Belegschaft und einen entsprechenden Vorrat an Lebensmitteln verfügte. Dort, wo die Aufenthalte sich etwas länger gestalteten, wurden sie natürlich mit alkoholischen Getränken bewirtet. Ich nahm das Essen zusammenmit der Dienerschaft ein. Wir landeten in Turuchansk – in der Stadt, in der die Brücken wie Dielenbretter knarren, von wo einst der schwierige Weg nach Mangaseja seinen Anfang nahm. Hier setzten sie mich infolge der vorangegangenen Trunkenheit sogar ans hinterste Ende des gemeinsamen Tisches. Nachdem die anderen schon ordentlich einen getrunken hatten, ging ich auf den kleinen Balkon hinaus, und vor mir eröffnete sich eine schwermütige Landschaft – zwei verkümmerte Birken und dürres Strauchwerk. Einer der Beamten, die mit mir hinausgekommen waren, klopfte mir auf die Schulter und meinte:
- Sieh nur, Junge, sieh nur … Für uns ist das die Krim, ein Kurort …
Schließlich kamen wir in Norilsk, im Norillag, an.
Im Bezirk der Flussmündung des mächtigen Jenisejs, 90 Kilometer vom Hafen Dudinka entfernt, zieht sich eine Kette nicht sehr hoher Berge hin, das Putorana-Gebirge. An seinem Fuße steht, von lodernden Feuern erleuchtet, Norilsk – die Aufbereitungsanlage, das Wärmekraftwerk, weitere Fabrikgebäude, Häuser, Schachtanlagen und Bergwerke – alles im Wesentlichen auf den Knochen von Gefangenen errichtet; bereits zu meiner Zeit arbeiteten dort 80-90000. Etwas näher an den Bergen standen Häftlingsbaracken mit Wachtürmen und ringsherum – nichts als Tundra, auf hunderte von Werst. Man hatte dort die Grundlagen zur Förderung von Erzen im Tagebau geschaffen, wo die Arbeit viel schwerer war.
Neun Monate Winter – wenn es am Tag für zwei Stunden dämmert; der Rest ist tiefste Nacht…. Es herrschte beharrlicher Dauerfrost – für gewöhnlich nicht weniger als vierzig Grad, selten minus fünfzig, aber das Schlimmste war, dass häufig ein heftiger Schneesturm einsetzte – mit Windgeschwindigkeiten von 50 m pro Sekunde, der den Menschen von den Füßen warf und Schneewehen hinterließ, die bis zum ersten Stockwerk hinaufreichten. Durch die Kraft des Windes wurde der Schnee zu Steinhärte zusammengepresst, und nach dem Schneesturm mussten sie Häftlinge in großen Kolonnen hinausbringen, um die Straßen und Wege frei zu schaufeln. Es gab einige Fälle, dass ein Mann vom Wind über den hart gewordenen Schnee fortgerollt wurde, nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen konnte und erfror…. Und über den Bergen und Fabriken leuchteten in den Polarnächten die märchenhaften Lichtblitze der Elmsfeuer.
In den Legenden über die Eroberung Sibiriens heißt es über eine Stadt: „Sie wurde in der eisigen, waldlosen Tundra aus Holz gebaut und war von kleinen Bergen begrenzt – das sind die Massengräber der Gefangenen. Während des langen, schweren Polar-Winters verminderte sich die Zahl der Sklavenarbeitskräfte: der Skorbut wütete überall, es gab Lungenerkrankungen und viele Krankheiten mehr … In der schiffbaren Zeit wurden in den Frachträumen der Lastschiffe neue Gefangene aus Krasnojarsk gebracht. Unter ihnen befanden sich auch Frontsoldaten mit Löchern in den Militärhemden, die vom Abreißen der Orden stammten. Nicht alle überlebten die lange Reise in den Frachträumen; die Leichen wurden nicht in den Jenisej geworfen, denn der Leiter des Gefangenentransports sollte in Dudinka genauso viele Individuen abliefern, wie er in Krasnojarsk verladen hatte.
Ungefähr in diesen Gegenden wurden Menschen wegen irgendwelcher Vergehen erschossen. Man konnte sich jedes beliebigen Häftlings, der einem irgendwie nicht passte, entledigen, indem man ihn ganz einfach mit irgendeinem Auftrag losschickte, indem man ihm die mündliche Erlaubnis zum Verlassen der Lagerzone erteilte und ihn dann kurzerhand wegen „Fluchtversuchs“ erschoss. Wie viele Gefangene das Kombinat in all den Jahren durchliefen, wie viele von ihnen ums Leben kamen – darüber ist auch heute kaum etwas bekannt.
Bei meiner Ankunft schickten sie mich sogleich in die Projektierungsabteilung
und erteilten mir den Auftrag, die Projektierung der Kontroll- und
Messeinrichtungen zu leiten (die Hauptprojektierung war ungefähr 1940 beendet).
Rein freie Mitarbeiter (mit Ausnahme des MWD-Personals und des militarisierten
Wachregiments) gab es in Norilsk vergleichsweise wenig; es handelte sich im
Wesentlichen um Ingenieure auf leitenden Posten, wie beispielsweise den Leiter
der Energieversorgung und der Aufbereitungsanlage. Es gab unter ihnen auch
solche, welche die Bauprojekte planten und leiteten, und diejenigen Ingenieure,
die hierher geschickt worden waren oder sich vom hohen Arbeitslohn hatten
verlocken lassen.
Aber das Hauptkontingent an durchschnittlichen Ingenieuren wurde dennoch aus
Spezialisten gebildet, die hier ihre Haft verbüßt hatten und aufgrund des
Stempels in ihrem Ausweis, den politische Gefangene bei ihrer Freilassung
bekamen, nicht das Recht besaßen, den Ort zu verlassen. Viele wollte man auch
einfach nicht fortlassen …
Manche Vorgesetzte sahen die Menschen lediglich als Masse von Individuen an, aber die Mehrheit an Ingenieuren mit qualifizierter Ausbildung (die auch weitestgehend in ihrem erlernten Beruf verwendet wurden) schöpften sie aus der allgemeinen Häftlingsmasse heraus (anhand von Dokumenten oder Angaben des Spionage-Netzwerks). Alles unterlag der Devise „Wir brauchen Nickel!“ Gelegentlich konnten sie sich ohne Wachbegleitung bewegen, manchen wurden sogar verantwortungsvolle Produktionsbereiche anvertraut (zum Beispiel der Stellvertreter des Ober-Ingenieurs für Energieversorgung Gordienko, und bei den Energiewissenschaftlern Aleksandrow und Gramp, war Jerusalimskij einer der Bergwerksleiter), und dabei hatten sie doch alle „schlechte“ Paragraphen.
Nach und nach nahm die Zahl der qualifizierten Arbeiter zu, die überwiegend freigelassen worden waren und danach in Norilsk blieben. Auch die Zahl der freien Mitarbeiter nahm zu, aber im Wesentlichen ruhte alles auf den Schultern der Häftlinge, und Erd- und Verladearbeiter sowie Schneeräumer waren ausschließlich Gefangene.
Einmal blätterte ich ein schönes Album mit dem Titel „Wie der Komsomol Norilsk erbaute“ durch – mit Fotos einiger leitender Genossen und verschiedenen Ansichten von Norilsk. Die Bilder waren meisterlich gemacht: auf keiner einzigen Fotografie sah man Häftlingsbaracken und Wachtürme. Das Wort „Häftling“ fehlte in diesem Album gänzlich.
Materiell waren die Verbannten mit den freien Mitarbeitern gleichgestellt; sie konnten auch das Kino im Haus der Ingenieure und Techniker besuchen. Allerdings gehörten Verbannte und solche, die eine Haftstrafe verbüßt hatten, zu „niederen Rasse, und das war auch zu fühlen. Die Leitung hielt ihre Gruppe zusammen. Kontakt mit den Häftlingen außerhalb dienstlicher Angelegenheiten war strengstens verboten. Diese Regel wurde natürlich während der Arbeit oft verletzt, wenn der Trupp ohne Wachbegleitung unterwegs war.
Aber egal, wer du auch warst, über allem schwebte unsichtbar das Gespenst des MWD. Du konntest niemals sicher sein, dass dein Nachbar oder Gesprächspartner kein Denunziant war. Bei einigen schöpfte man nur Verdacht, bei anderen wusste man es genau. Deswegen wurden gewöhnliche Alltagsunterhaltungen stets eingeschränkt und mit äußerster Vorsicht getätigt – um einen herum herrschte eine Atmosphäre der Angst und des Misstrauens. („Ich kenne kein anderes Land, in dem der Mensch so frei atmen kann“).
Einmal hielten sie mich zwei Wochen lang im Gefängnis fest; dann entließen sie mich, und ich kehrte auf meinen vorherigen Platz zurück. Damals hatten sie mir in belehrendem Tonfall gesagt: „Schwatz‘ nicht so viel, Junge!“
Die Verbannten hatten völlige Bewegungsfreiheit. Wohin sollten sie denn auch sonst laufen? Im Norden – das Eismeer, im Westen und Osten – tausende Kilometer menschenleerer Taiga, und auf dem Jenisej … Die gesamte Bevölkerung wusste, dass sie für Mitteilungen über eine Flucht sehr gut mit Hilfe von Gutscheinen bezahlt würde, die in Läden der Unionsvereinigung für den Handel mit Ausländern eingelöst werden konnten. In der Brigade, die uns bediente, gab es einen Gefangenen, der es schaffte, bis in den Bezirk Igarka zu fliehen, aber es war ihm nicht in den Sinn gekommen, das Mädchen zu töten, welches ihm den Weg durch die Taiga gewiesen hatte. Er wurde aufgegriffen; sie „verbeulten“ ihn ein klein wenig (aber zum Krüppel machten sie ihn nicht - schließlich brauchten sie ja Sklavenarbeiter) und brachten ihn dann wieder zurück, wonach er eine zusätzliche hohe Haftstrafe aufgebrummt bekam.
Ich erinnere mich auch noch an einen anderen Vorfall: ein Gefangener wollte überhaupt nicht in die Freiheit entlassen werden. Als man ihm mitteilte, dass er entlassen werden sollte, fiel er vor dem Tschekisten auf die Knie nieder und flehte ihn an, ihn doch im Lager zu lassen. Es war ein schon älterer Bademeister, der im Badehaus wohnte und arbeitete. Angehörige hatte er keine mehr, es gab keinen Ort, an den er hätte fahren können, während er hier ein warmes Eckchen und seine tägliche Essensration hatte, die ihn nicht verhungern ließ. Einen anderen Ausweg zum Überleben gab es für ihn nicht.
Das Wort „Genosse“ war damals wenig gebräuchlich. Die Obrigkeit redete man meist mit Vor- und Vatersnamen an, einen guten Bekannten lediglich mit dem Vornamen. Ein Gefangener, der im Arbeitstrupp unvorsichtigerweise diesen Begriff benutzte, erhielt zur Antwort: „Der Wolf im Wald ist dein Genosse“ (entgegen der offiziellen Version: „Unser stolzes Wort „Genosse“ ist uns mehr wert, als alle schönen Worte“).
Später versetzten sie mich zum zentralen Energetik-Laboratorium. Hier bestand das ganze wichtige Personal aus Gefangenen – der erfahrene Elektrotechniker Bobrowitsch, der mit dem Wärmetechniker Kenig bekannt war, der junge Mitarbeiter Belostozkij, der Mechaniker Gabrieljan, der bei der Mehrheit der Chefs immer die Uhren reparierte.
Es war mir beschieden, im Jahre 1947 für zehn Tage aus geschäftlichen Gründen nach „Tajoschnij“ zurückzukehren. Eine lustige Episode. Ich hatte ein wenig freie Zeit und spazierte durch den Wald. Als ich plötzlich lauten Gesang vernahm, machte ich mich auf die Suche, um nachzuschauen, was es damit auf sich hatte. Auf einer großen Lichtung liefen gefangene Frauen herum, die beim Beeren-Sammeln waren und dabei das Lied „damit nicht hinterlistige Münder heimlich die herrschaftlichen Beeren essen“ (A. Puschkin). Ein klangvoller Mezzosopran sang das solo: „Ach, für die Obrigkeit…“, und ein mächtiger Chor stimmte ein: „abgeben müssen, abgeben müssen…“. Danach fuhr ein durchdringender Kontra-Alt fort: „Ach, schimpft deine Mutter, … abgeben müssen…“. Im weiteren Verlauf folgte das Aufzählen der Lagerleitung in absteigender Reihenfolge.
Meine Haftzeit lief 1948 ab. Ende 1950 gelang es mir von dort fortzufahren. Urlaub bewilligten sie bereits, aber nach Moskau durfte ich erst 1955 zurückkehren, als der Mann die Erde befreit hatte, der am dunkelsten Tag des Jahres geboren wurde.
Kehren wir jedoch nach Norilsk zurück. Die Tschekisten siedelten in den Baracken, zusammen mit höchst kulturell veranlagten „Politischen“, auch eingefleischte, professionelle Kriminelle, an. Die Lagerzone wurde zu einem kleinen souveränen Staat, wo eigene Verbrechergesetze aufgestellt wurden, die mit unter Androhung von Bestrafung unter größter Angst einzuhalten hatte. Hier hatte man seine „Aristokraten“, „Gangsterbosse“, es gab sogar ein „Verfassungsgericht“ in Gestalt eines älteren Kriminellen-Anführers, der praktisch sein ganzes Leben lang in der Lagerzone zugebracht hatte.
Politische Gefangene mit nicht benötigten Berufen wurden für allgemeine Arbeiten verwendet – zusammen mit den Kriminellen. In der Baracke hielt sich immer eine kleine Gruppe überzeugter Krimineller auf – sie besaßen in der Baracke die Vormachtstellung und hielten Arbeit für eine Schande, erhielten deswegen auch nur eine kleine Essensration und nahmen die Arbeitenden nach Strich und Faden aus. Sie umgingen die Arbeit auf originelle Art und Weise: eine der Verbrecherinnen nähte sich mehrere Knöpfe an den Bauch. Der entlarvte oder so gut wie glaubwürdig enthüllte Denunziant wurde verurteilt.
Einmal spielte sich ein blutiges Drama ab. Die Kriminellen, die in einer Baracke lebten, beschlossen, eines nachts die Miststücke in der Nachbarbaracke zu bestrafen. Aufgrund eines dummen Streichs fügte es sich so, dass die Lagerleitung, die von dem Komplott nichts wusste, die abtrünnigen Kriminellen, die dem Verbrecherkodex nicht mehr treu gewesen waren, einen Tag vorher in eine andere Baracke verlegt und dafür hier eine neu angekommene Partie Gefangener untergebracht hatte – arbeitsfähige Kriegsinvaliden. Ohne dies zu wissen, zettelten die Kriminellen in der Nacht ein blutiges Gemetzel an, welches die alarmierten Wachmannschaften nur mit Mühe besänftigen konnten.
Am schlimmsten erging es den ehemaligen professionellen Partei- und Komsomol-Mitarbeitern: sie wurden gleichsam zum Hohn an die schmutzigsten und schwersten Arbeitsplätze geschickt. Unter den politischen Häftlingen gab es welche, die in Freiheit antisowjetische Reden geführt hatten, Kolchosbäuerinnen, die ein paar Ähren gesammelt hatten, die nach der Ernte auf dem Feld zurückgeblieben waren, verwundete Soldaten, welche die Deutschen in bewusstlosem Zustand aufgehoben hatten und die nun als Vaterlandsverräter galten – ohne nähere Untersuchung und Gerichtsverhandlung („Sie haben furchtlos fremde Großstädte betreten, und nun kehren sie voller Angst in ihre eigene zurück“. – I. Brodskij). Der Bewohner einer Gemeinschaftswohnung litt darunter, dass sein dreijähriges Söhnchen die Zeitungen in Stücke gerissen und beschmutzt hatte, in der ein großes Porträt Stalins abgebildet gewesen war. Viele waren wegen eines einzigen unvorsichtigen Wortes in eine derart missliche Lage geraten.
Die hochqualifizierten Spezialisten und Arbeiter der dringend benötigten Berufsprofile konnten noch einigermaßen überleben, aber das Überleben bei den allgemeinen, ungelernten Arbeiten war schwieriger. Die nationale Zusammensetzung bei den Häftlingen war ganz bunt gewürfelt: Vertreter slawischer Völker von Polen bis Sibirien, Bewohner der baltischen Staaten, ein Ladearbeiter aus Leningrad – der Finne Kaibijainen, der irgendeine „unpassende“ Äußerung über den Angriff im Jahre 1940 gemacht hatte. In die Verbannung geraten war auch Mischka Jerkin, die haargenau zwei Wochen vor Kriegsausbruch einen Deutschen geheiratet hatte.

Unter den von mir beschlagnahmten Dokumenten hatte sich auch das Büchlein eines Sportmeisters befunden; somit wurde ich damit beauftragt, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine Mitarbeitergruppe im Fahren mit Bergskiern zu unterrichten und sie zu trainieren. Dazu gehörten ein paar freie Mitarbeiter, aber hauptsächlich kamen Spezialisten und Ingenieure, die hier ihre Strafe abgesessen und nicht die Erlaubnis erhalten hatten nach Hause zu fahren; hier fand sich auch der Geologe Urwanzew, der diese Fundstätte besichtigt und untersucht hatte und dann 10 Jahre hier verbüßte.
Sich mitten im Winter auf Skiern fortzubewegen ist riskant: es ist dunkel und gefährlich wegen der häufig und urplötzlich heranwehenden grausamen Schneestürme, aber während des kurzen Sommers konnte man auch um 12 Uhr nachts bei Sonnenlicht herumlaufen.
Der Unterricht war von Nutzen. Irgendwann im März wurden alle aufgerufen, die Skifahren konnten: ein Flugzeug des Kombinats, das über Igarka flog (10 Minuten Flugzeit bis nach Norilsk), war verschwunden. Drei Tage fuhren wir in der Tundra umher, erklommen die Berge, um eine bessere Sicht zu haben, und am vierten Tag erhielten wir den Befehl zurückzukommen: der Pilot Werebrjusow war irgendwo in einer Siedlung gelandet und hatte mit den mitfliegenden, Verantwortung tragenden Mitarbeitern des Kombinats ein Trinkgelage veranstaltet, wobei er bei der Gelegenheit auch alle Einheimischen der Region betrunken machte.
Einmal schickten sie mich im Winter nach Krasnojarsk, um dort Geräte zu bekommen Wir flogen zu zweit mit einem kleinen Flugzeug P-5,(die Deutschen nannten es „Rusfaner“ – „russisches Furnierholz“; Anm. d. Übers.) – ich und der stellvertretende Versorgungs-Chef des Kombinats, so dass ich unter Aufsicht stand.
Wir übernachteten in Podkamennaja Tunguska. Die Wintertage sind kurz, man bewegt sich langsam voran, und die Flugplätze sind nicht beleuchtet. Und so machten wir uns auch wieder auf den Rückflug, aber wenig später stellte sich heraus, dass wir es versäumt hatten, den Treibstoff aufzufüllen – er würde nur bis Turuchansk reichen – und dort mussten wir abends dann auch landen. Hier stürzte sich ganz unverhofft sogleich das gesamte Personal auf uns. Im Nu hatten sie das Flugzeug aufgetankt, alles in Ordnung gebracht, was notwendig war und gaben gleich wieder das Startzeichen. Der Pilot murmelte irgendetwas über die Wetterprognose und die Bereitschaft der Stadt Igarka uns aufzunehmen, aber man schickte uns eilig fort. Die Erklärung dafür ist ganz einfach: wir schrieben den 31. Dezember, und wer müht sich da schon gern nach der Begrüßung des neuen Jahres mit einem Flugzeug ab.
In Igarka landeten wir, als es bereits vollständig dunkel war – der Pilot hätte beinahe neben der Landebahn aufgesetzt. Sie begrüßten das neue Jahr in einem Gästehaus für leitendes Personal. Der Chef war demokratisch veranlagt und besaß zudem auch noch ein Deckelkrüglein mit Schnaps. Am nächsten Morgen gingen wir zum Flugplatz hinaus, aber es gelang uns nicht, irgendeinen Angehörigen des Dienstpersonals zu finden (Seeleute sagen: „Wenn du gemütlich schlafen willst – dann schlaf in einer fremden Kajüte“).
Zu dritt schafften wir es nicht den Motor anzulassen. Wir mussten mit einem
Seil den eingefrorenen Propeller sowie den Magnetzünder drehen (der Starter
funktionierter nicht!).
Schließlich begaben wir uns ins Gasthaus, um etwas zu essen und zu trinken. Auch
am zweiten Tag fand sich niemand auf dem Flugfeld; sie begegneten lediglich
einem Wärter, der uns einen abgemagerten Klepper zur Verfügung stellte, aber
auch jetzt wurde aufgrund der „technischen Indisponiertheit“ der Mähre und ihres
Mangels an Enthusiasmus nichts aus unserem Vorhaben. Erst am dritten Tag hatte
sich das Dienstpersonal allmählich von der Begegnung mit dem neuen Jahr erholt,
und wir konnten endlich nach Norilsk fliegen.
Der Winter dauerte lange und war sehr streng, aber im Frühling (Mitte Juni) konnte man fünf-sechs Kilometer weit in die Tundra hineingehen. Sie blühte üppig, als ob sie sich beeilte, die Zeit in den kurzen Sommermonaten aufzuholen. Hier bemühten wir uns für kurze Zeit die Baracken und Wachtürme zu vergessen.
Das Lager machte mich mit dem berühmten Fußballer Andrej Petrowitsch Starostin bekannt, einem Gefangenen, der nicht mehr unter Wachbegleitung stand. Er war durch seinen besten Sportsfreund hierher geraten. Damals hieß es – ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es klang zumindest glaubwürdig - dass die Brüder Starostin durch Berija hergeschickt worden wären, einem leidenschaftlichen „Dynamo“-Anhänger, um den Konkurrenten „Spartakus“ mit seinen besten Spielern loszuwerden. Starostin hatte den Auftrag erhalten, den Sport am Kombinat zu leiten. Faktisch war er auch Trainer in der Sporthalle. Klug und scharfsinnig war Andrej Petrowitsch und ein äußerst 8interessanter Erzähler, wobei er in den Jahren seins Ruhmes von den ihn umgebenden Anhängern, wie Schauspieler mit dem Niveau eines Janschin, eine Menge aufgenommen hatte – und er las gern und viel Schriftsteller wie beispielsweise Olescha.
Im Gedächtnis geblieben sind Begegnungen mit dem nicht mehr unter Bewachung stehenden Künstler Mangolds – einem Letten, der die Akademie der Künste in Riga und Paris absolviert hatte. Er hatte von irgendwoher Farben und Papier erhalten und malte ganz hervorragende Aquarelle: Ansichten von Norilsk, tropische Wälder. Viele kauften diese Bilder von ihm gegen Lebensmittel, selbst hochgestellte Persönlichkeiten, über die er auch die Malfarben bekommen hatte. Aufgrund seines Mal- und Zeichentalents hatte man ihn auch von der Wachbegleitung befreit (er war schon betagt). Ich habe noch einige seiner Zeichnungen aufbewahrt; die beiden besten habe ich A.I. Solschenizyn geschickt.
In Norilsk begegnete ich ebenfalls dem mir noch aus Moskau bekannten jungen Alpinisten A. Poljakow – dem Sohn einer der Akteure während der Revolution, der noch in den ersten Jahren des Umsturzes starb und dessen Sohn danach unter N.W. Krylenkos Vormundschaft gestellt wurde. Er war an Krylenkos Pamir-Expeditionen beteiligt und bekam nach Krylenkos Verurteilung (weil er ihm so nahe stand) 10 Jahre aufgebrummt. Außerdem lernte ich den scharfsinnigen Korrespondenten der „Iswestija“ – Garri – kennen, der hier seine Haftstrafe verbüßt hatte und bald darauf abreisen durfte.
Auch möchte ich Wolodja Bure erwähnen – den Schwimmmeister der UdSSR, der ebenfalls durch den Willen des Führers in Norilsk lebte, einem Mäzen der Körperkultur, des Sports.
Einmal musste ich zur Überprüfung von Messgeräten einen Kohlenschacht aufsuchen. Am Schachteingang versah eine Frau ihren Dienst, die, wie alle anderen auch, in von Kohlenstaub geschwärzte Lumpen gehüllt war. In dem schwarz gefärbten Gesicht sah man nur die Augen und Zähne. Wir sprachen miteinander. Es stellte sich heraus, dass sie Wolga-Deutsche war, und die Unterhaltung ging auf Deutsch von statten:
- Ich bin in Amerika geboren.
- ?
- Mein Vater war Wolga-Deutscher, recht wohlhabend, er war offenkundiger Demokrat, und das Regime der Zarenregierung passte ihm nicht – er emigrierte nach Amerika. Dort wurde ich geboren. Als hier Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit Einzug hielten, beschloss er zurückzukommen: Nachbarn hatten seinen Grund und Boden für ihn erhalten. Er wurde ziemlich schnell enteignet und in die Region Krasnojarsk verschleppt, wo er starb. Mit Beginn des Krieges siedelten sie mich, eine Deutsche, hierher aus. Die Arbeit als Verbannte in einem Schacht ließ mich wenigstens am Leben bleiben.
Eine meiner anderen Bekannten, Vera Iwanowna Semjonowa, war eine Frau mit kaukasischem Äußeren. Es stellte sich heraus, dass sie eine typische Aserbeidschanerin aus Baku war. Aber ihre Geschichte war komplizierter.
1916 waren russische Truppen auf türkisches Territorium vorgedrungen. Eine Kompanie drang nach der Artillerie-Ausbildung in ein kleines Dörfchen ein – mit den lauten Rufen „Tudit tvoju…“ (was nach einem türkischen Militär-Wörterbuch zufällig auch so viel wie „für Glaube, Zar und Vaterland“ bedeutete). Das Dorf haben schon längst alle Bewohner verlassen.
Der russische Soldat Iwan Semjonow entdeckte in einer halbzerstörten Lehmhütte ein in panischer Angst zusammengekauertes schwarze Häufchen – ein Mädchen von etwa fünf Jahren. Das Mädchen blickte erschrocken auf das große Wesen mit den rötlichen Haaren und den blauen Augen (Semjonow stammte aus Rjasan). Der Soldat liebte Kinder – auch wenn sie asiatisch-mongolischer Abstammung waren, schließlich waren sie doch alle Kinder! Seine Hände erwiesen sich als gut; er brachte das Mädchen im Wagenzug beim Gevatter unter. Die Soldaten hatten Mitleid mit dem Mädchen (sprechen konnte keiner mit ihr), aber jeder ließ ihr eine Kleinigkeit zukommen – der Eine ein Stückchen Zwieback, ein Anderer ein Stückchen Zucker.
Die Revolution war ausgebrochen, die Front fiel auseinander, Iwan kehrte ins heimatliche Rjasan zurück. Das Dorf freute sich über die Nicht-Christin keineswegs, der Pope war ungehalten, aber nachdem Iwan mit ihm ein Viertelchen getrunken hatte, kamen sie schon ganz gut miteinander aus, und seine Vera wurde zu Ehren der Mutter getauft.
Das Mädchen wuchs heran, erlernte die Sprache, beendete die Schule und absolvierte sogar das Institut. Der „Vater“ starb, sie heiratete einen Ingenieur, gebar ein Kind. 1937 wurde ihr Ehemann zum „Volksfeind“ erklärt, sie selber erhielt als türkische Spionin 10 Jahre, das Kind wurde unter einem anderen Nachnamen in ein Kinderheim geschickt. Als ich sie kennenlernte, war sie bereits freigelassen worden. Sie hätte von dort fort6fahren solle – aber wohin? In die Türkei? In das Dorf, in dem es keinerlei Verwandte gab? Immerhin bekam man hier seinen Lohn und seine Essensration ….
Im rauen Norilsk gibt es einen Tag der Freude – den 8. Februar: um die Mittagszeit lugte über den Bergen für zehn Minuten zum ersten Mal ein winziges Stückchen Sonne hervor. Alle, die es irgendwie einrichten können, lassen ihre Arbeit ruhen und laufen los, um sie zu begrüßen. Die Fenster von Veras Zimmer zeigten gen Süden. Dort stand sie und schaute traurig hinaus …
An was mochte Vera, Sufia, Sylfia, Schagane wohl gedacht haben? … Wie viel verdorbenes, verstümmeltes Leben hing mit diesem Norilsk zusammen ….